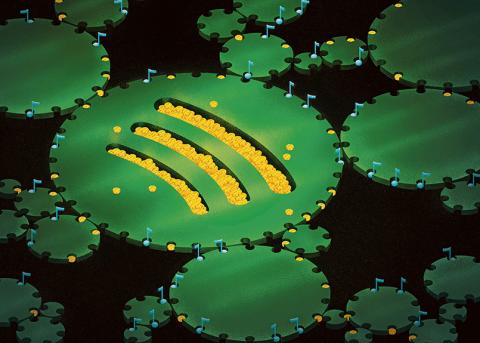Digitale Revolutionen 1: «Musiker müssen sehr visuell denken»
Als Veranstalter und DJ brachte Andreas Ryser einst den Linksalternativen die elektronische Clubmusik bei. Heute nutzt er als Musiker und Labelbesitzer die neuen Möglichkeiten im digitalen Vertriebssystem.
Im Musikbereich gab es zwei grosse digitale Revolutionen. Die erste fand auf Produktionsseite statt. Sie hatte ihren Höhepunkt in den neunziger Jahren, als immer mehr MusikerInnen mittels Software auf Apple-Computern elektronische Musik schufen – und ohne teuren Besuch eines professionellen Studios auch gleich aufnahmen. Die zweite digitale Revolution betrifft den Vertrieb und Konsum von Musik. Sie erreicht gerade jetzt einen neuen Höhepunkt, da nach der CD auch der digitale Download an Bedeutung verliert – zugunsten von Streaming.
Andreas Ryser war und ist bei beiden Umwälzungen mittendrin. Als Ryser Mitte der neunziger Jahre in die Veranstaltungsgruppe des Berner alternativen Kulturzentrums Reitschule kam, waren dort ausschliesslich Punk und Hardcore angesagt. Ryser interessierte sich hingegen für Hip-Hop und elektronische Clubmusik. Zusammen mit seinem Kollegen Kevin Müller organisierte Ryser erste Clubnächte, bei denen vor allem DJs und Laptops bedienende Frickler auftraten. «Innerhalb der Reitschule gab es riesige Widerstände dagegen», erinnert sich der heute 41-Jährige, «wir konnten die anderen nur langsam davon überzeugen, dass Hip-Hop und elektronische Musik besonders in England eine alternative Sache waren.» Im Reitschul-Establishment wurde solch tanzbare Musik noch eine Weile lang verdächtigt, vornehmlich eine konformistische Konsumhaltung zu befördern, weshalb DJ-Auftritte vorerst nur zweimal pro Monat stattfinden durften. Trotzdem wurden die Clubnächte namens Mouthwatering bald zu einem grossen Erfolg – und die Reitschule zu einem Ort, wo über Jahre die angesagtesten Acts progressiver Clubmusik auftraten.
Listige Laptopmusiker
Als DJ Dustbowl bespielte Ryser die eigenen Clubnächte und trat mit dem experimentellen Kontrabassisten Mich Gerber auf. Doch der autodidaktische Technikfreak, der eine Lehre als Dekorationsgestalter gemacht hatte, wollte auch in die eigentliche Musikproduktion einsteigen. 2003 gründete er zusammen mit dem Programmierer Daniel Jakob – ganz im Sinn der ersten digitalen Revolution – ein Laptopduo. Doch die zweite digitale Revolution war da gerade angelaufen und zeigte sich von einer hässlichen Seite: «Durch die weitverbreitete Internetpiraterie, durch das Filesharing, war die Musikindustrie in eine tiefe Krise geraten», sagt Ryser. «Wir hatten schon gar keine Hoffnung, durch Plattenverkäufe irgendwelches Geld zu verdienen.» Doch Ryser und Jakob wollten einfach ihre ersten Tracks unter die Leute bringen, stürzten sich Hals über Kopf in die neue Realität und deuteten die Krise in eine Chance um.
Schon der Bandname spiegelt dies wider: «Filewile» bedeutet so etwas wie eine listige Computerdatei. Dabei schauten die beiden auch, dass der Bandname einmalig war und bei Google eine hundertprozentige Trefferquote ergab. Und dann veröffentlichte das Duo jeden Monat einen neuen Song auf seiner Website – als Gratisdownload mit freiwilliger Zahlungsmöglichkeit. «Wir waren unter den Ersten, die das so machten», erinnert sich Ryser. «Das sprach sich schnell herum, und wir hatten gegen 700 000 Downloads.» Filewile war die erste Band, deren Videoclip auf dem deutschen Musik-TV-Sender Viva lief, ohne dass der Song über kommerzielle Kanäle zu kaufen gewesen wäre.
Ziel war es, möglichst rasch bekannt zu werden. Das gelang auch über die Landesgrenzen hinaus, weil das Duo als Laptop bedienende Strassenmusiker durch verschiedenste europäische Städte zog und so zusätzliche mediale Aufmerksamkeit generierte (denn das galt vor zehn Jahren noch als ein skurriles Unterfangen). Insgeheim hofften die beiden Berner aber auch, dass genügend Leute bereit wären, für die Songdownloads etwas zu bezahlen. «Das hat überhaupt nicht geklappt, da waren wir zu naiv», sagt Ryser.
Wichtige Konzerteinnahmen
Immerhin, der hohe Bekanntheitsgrad führte dazu, dass die später aufgenommenen und über die üblichen kommerziellen Kanäle vertriebenen Alben wenigstens etwas zum Einkommen der Musiker beitragen. «Der Tonträgerverkauf macht dabei jedoch kaum zehn Prozent aus», sagt Ryser. «Neben der Kulturförderung sind vor allem Konzerteinnahmen wichtig – und Einkünfte durch das Urheberrecht, wobei uns vor allem zugutekommt, dass wir innert drei Jahren ebenso viele erfolgreiche Radiosongs hatten, die auch im Ausland gespielt werden.»
«Tonträger», das bedeutet heute nur noch zu einem geringen Teil eine CD oder gar eine grosse schwarze Platte – obwohl sich Filewile 2009 den Luxus leisteten, mittels Crowdfunding ein Album als aufwendiges Doppelvinyl zu veröffentlichen. «Wir machen heute etwa dreissig Prozent des Umsatzes bei Tonträgern über Downloads und Streaming», sagt Ryser. Und Streaming – bei dem über Plattformen wie Spotify oder Youtube Musik direkt online konsumiert wird – löst die legalen wie auch die illegalen Downloads mehr und mehr ab. Spotify hat derzeit weltweit 24 Millionen NutzerInnen, von denen immerhin 6 Millionen eine monatliche Gebühr von rund zwölf Franken entrichten und damit werbefreien Zugriff auf einen riesigen Musikkatalog haben. «Musikpiraterie ist für uns kaum ein Thema mehr», meint Ryser.
Ein riesiger Plattenladen
Dank Streaming lässt sich auch wieder Geld verdienen. Am meisten tun dies die grossen Musikkonzerne, die, nachdem ihnen schon der Niedergang sicher schien, nun als erste Medienbranche im Internet Profit machen. Sie nutzen insbesondere neu zugängliche, riesige Märkte in Schwellenländern wie etwa Indien, die vom Kassettenzeitalter direkt in das digitale Mobilgerätezeitalter katapultiert wurden.
Doch Ryser sieht auch für MusikerInnen und Independentlabels neue Chancen. Mit Mouthwatering Records führt der Berner ein solches kleines Musiklabel, das nicht nur für die eigene, sondern auch für etliche andere Bands Verlags- und Managementaufgaben übernimmt und Tonträger herausgibt. «Das Internet ist wie ein riesiger Plattenladen, in dem man sich auch als kleinere Nummer selbst promoten kann», sagt Ryser. «Dazu ist vor allem der visuelle Auftritt entscheidend, denn online nimmt man zuerst Bilder wahr, bevor man sich allenfalls entscheidet, einen Song anzuhören.»
Streaming bringt allerdings nur dann nennenswerte Einnahmen, wenn die Songs auch wirklich oft abgespielt werden. Spotify entrichtet derzeit pro gestreamten Song durchschnittlich nicht viel mehr als einen halben Rappen. Aber auf jeden Fall sei eine Tendenz erkennbar, dass die Urheberrechte gestärkt werden, sagt Ryser. «Ich weiss nicht, ob ich ohne Internet mit der Musik mehr Geld verdienen würde. Die Entwicklungen sind enorm, und es ist kaum vorherzusagen, wohin sie führen. Veränderungen bedeuten immer auch neue Chancen.» Revolutionen, digitale und andere, haben eben selten einen sicheren und vorhersehbaren Ausgang.